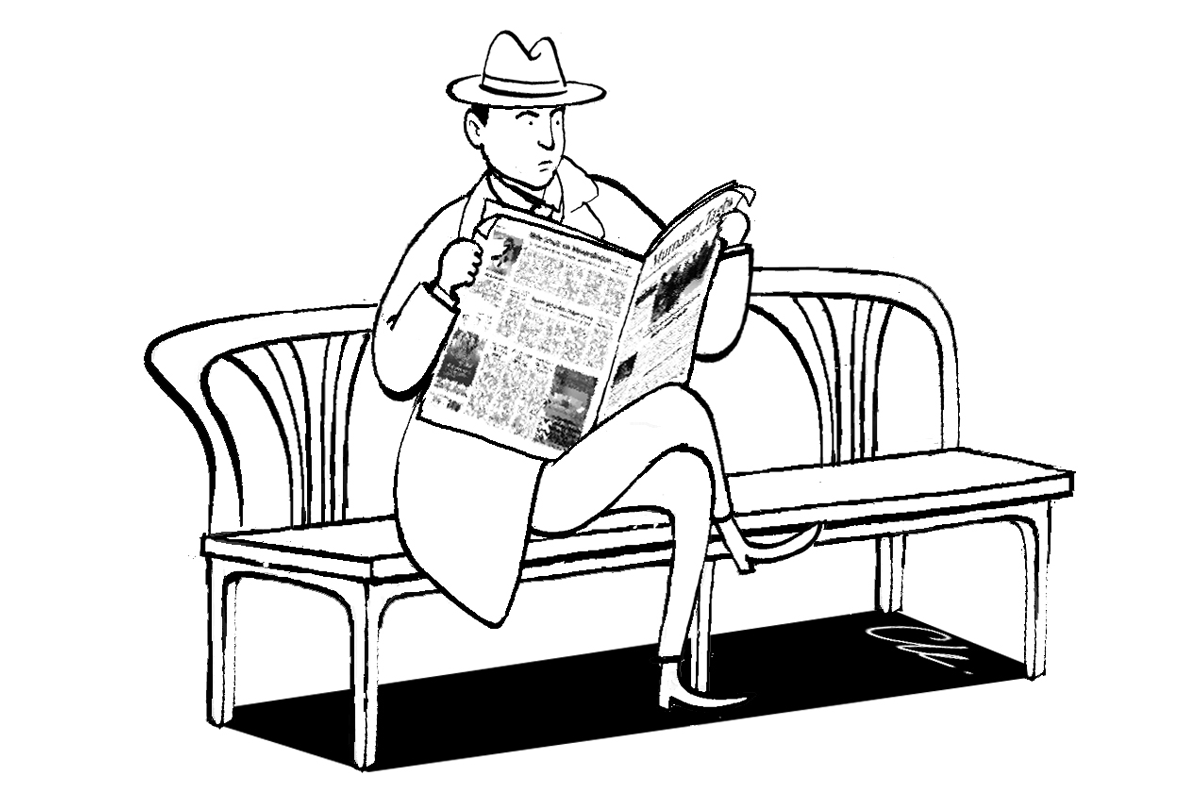Kirchentag und soziale Gerechtigkeit
Die neue Gemeindebücherei
Als was komme ich in die Welt
Ödön auf der Seidlbank
Lockere und alltagsphilosophische Gedanken zu den letzten vier Wochen.
Plötzlich ist es Sommer geworden, Pfingsten gerade vorbei, der Juni hatte gerade begonnen. Ein kleines touristisches Sprachengewirr vor mir auf der Seidlbank in der Fußgängerzone. Ödön setzt sich zu mir, blättert im Buch, das neben mir liegt. „Der erste Schritt“*? Ein fragender Blick. Ja, Ödön, ein aufregendes Buch. Eine poetische Parabel. Nicht wie so oft in unseren Gesprächen bisher geht es hier nicht um unseren ökologischen Fußabdruck, den wir auf unserer Erde hinterlassen, nicht um fossile Energien und Emissionen. Hier geht es um die Transzendenz, die wir brauchen, aber in unserem politischen Streit nicht mehr betreten. Transzendenz als eine Dimension, die über unsere Erfahrung hinausgeht.
In Nürnberg diskutieren sie gerade darüber auf einem Kirchentag. Kein Ort für dich? Vielleicht aber wenn ich dir sage, worüber es in Nürnberg zentral ging? Um den Mut, wie die Frage nach der sozialen Gerechtigkeit beantwortet werden kann. Aber zuerst beantworte ich dir, wo ich das Buch gefunden habe, in dem du gerade blätterst: In der umgebauten und erweiterten und neu gestalteten Gemeindebücherei in Murnau.
Auch deine Bücher findest du dort, Ödön, im Murnauraum. Aus dem Regal können deine Bücher direkt auf die Bäume blicken, die auf dem Platz stehen, der deinen Namen trägt. Daneben viele Reisebücher. Eine Anspielung auf die aufgezwungene Rundreise um Deutschland, als man dich hier nicht mehr haben wollte? Emanuel, in deiner Bank, du musst jetzt nicht murren. Noch stehst du zwar nur im Archiv der Gemeindebücherei und in dem des Marktes, aber bald werden Tischvitrinen dich immer mal wiederaufnehmen, um den Murnauern zu zeigen, was alles sie auch dir zu verdanken haben.
„Zeugnisse berühmter Persönlichkeiten“, so titelt das Tagblatt über eine erste Ausstellung. Sie zeigt zurzeit schon, wie attraktiv solche Vitrinen sein können. Peter König, ein pensionierter Murnauer Postbeamter, zeigt eine Auswahl seiner gesammelten Schätze. Begonnen hat er mit Briefmarken, aber mehr und mehr kamen Autografe dazu, also Handgeschriebenes. Durch die Schrift rückt man halt einer Persönlichkeit näher. König zeigt auf ein Beispiel, Walter von Molo.
Warst du, Ödön, auch schon ein Sammelobjekt signierter Bücher, Theaterhefte und Porträtkarten? Statt Briefmarken sind heute vermehrt Autogrammkarten das Sammelobjekt. Und neugierige und erstaunte Gesichter umlagern so Königs Schätze in der Tischvitrine. Emanuel, du kannst ahnen, wie umlagert die Schätze von dir erst sein werden. Eine Seidlschau in Tischvitrinen, ich sehe schon die gebeugten Köpfe rund um die Vitrine mit den Schätzen aus dem Lager der Bücherei und denen des Marktarchivs, die dich Emanuel, den großen Architekten und Murnauveredler, mit offenem Mund bestaunen. „Zeugnisse berühmter Murnauer“.
Wenn sich dann auch noch die Horváth-Gesellschaft dem Bündnis anschließt, das Schloßmuseum, mit einer monatlich wechselnden Leihgabe eine Vitrine füllt, dann wird aus der Gemeindebücherei mehr als ein Buchverleih, ein bequem erreichbarer alltäglicher kultureller Treffpunkt. Ich war dort, Ödön. Auf den Tischen beim Eingang die ausgelegten Neuanschaffungen. Toll aktuell. Ein Cover sprang mich an. Ein aufrechtstehender Hund im Pastorengewand, hinter und neben ihm zwei Gruppen gleich uniformierter Kinder. Ich hatte einen poetischen Schatz gefunden. Du hast ihn in der Hand. Ein Kinderbuch, Ödön, aber ein Glücksfall auch für Erwachsene.
Die Schwedin Pija Lindenbaum hat die Welt in zwei ungleiche Hälften geteilt. Eine Schule und drei Wohnhäuser. In dem mit den roten Fensterläden wohnen die Ringelblumen, in dem mit den grünen die Primeln. Hinten am Waldrand, in einem Baumhaus, wohnt die Schäfin. Oft liegt sie auch in einer Hängematte. Sie hat auch die Linie gezogen, damit die eine Hälfte der Welt, die der Kinder, sicher ist. Niemand darf die Linie überschreiten. Aber auch die Kinderwelt hat sie rigide geteilt. Die Primeln müssen Kartoffeln schälen, Stiefel putzen, Wäsche waschen und Steine schleppen. Die Ringelblumen malen, hopsen auf dem Trampolin, lernen Blumen und Pilze zu benennen, dürfen auf der Wiese liegen und nach den Wolken schauen, die vorüberziehen. Sie haben Privilegien, die anderen schuften. Nur der Haarschnitt ist bei allen gleich. Dafür sorgt die Schäfin. Unter ihrer tellerförmigen Halskrause eine Trillerpfeife, die wie ein Kreuz um den Hals hängt. Jedes Kind bekommt von ihr den gleichen Topfschnitt verpasst. Diese Welthälfte ist, wie sie ist. Warum sie ändern?
Weil einer bei den Ringelblumen erkennt, dass es ungerecht ist. Die anderen Ringelblumen stimmen ihm zu. Eines Nachts tauschen sie mit den Primeln die Kleider. An einem Mittwoch ist dann der Haarschneidetopf verschwunden. Unauffindbar. Die Haare wachsen, die Tage vergehen. Das Durcheinander wächst. Die ersten Kinder nähern sich der gezogenen Linie, die die Welt in zwei Hälften teilt. Ein Fuß, ein erstes Kind geht über die Linie. Ein erster Schritt ist getan, die falsche Idylle zu beseitigen.
Ja, Ödön, das ist Lindenbaums Parabel über die gleichberechtigte Teilhabe an Möglichkeiten, die auch anders vergeben sein könnten und es oft nicht sind. „Der erste Schritt“ *, eine Parabel der Welt, die doch auch dein Thema ist. Es gibt in dieser Parabel keine Lösung. Aber es ist ein Bilderbuch, und das vermag eine anzudeuten: Es wechseln die Farben. Das Wasser, das Gras, mal ist es gelb, mal blau und dann auch rot. Eine Linie überschreiten und dann wechseln die Farben. Ich grüble mich von Lindenbaums Parabel zurück zum Kirchentag in Nürnberg und zu seinem Thema der sozialen Gerechtigkeit.
Ich hole uns John Ralws, den amerikanischen Rechtsphilosophen auf die Bank. Vor mehr als einem halben Jahrhundert hat er ein kleines Gedankenexperiment entwickelt. „Das menschliche Zusammenleben ist im Grundprinzip immer so zu gestalten, als wüßte man selbst nicht, als was für ein Mensch man auf die Welt kommen wird. Reich, arm, als Mann, als Frau, als Mensch, der aus seiner Heimat flüchten muss? Natürlich, wir kennen die Sitation in der wir stecken, und natürlich setzen wir uns für die Regeln ein, die für unsere Lebenssituation vorteilhaft sind. Stattdessen müssten wir aber Regeln aufstellen, unter denen wir in jedem Fall auch bereit wären, selbst zu leben. Egal, welches Los wir auf Erden ziehen, es werden gerechte Regeln sein“. Ja, Ödön, wir scheinen uns heute in der gemütlichen Vorstellung eingerichtet zu haben, dass wir auf der Sonnenseite des Lebens geboren worden sind und dass es uns freisteht, ob wir unser Glück nun mit anderen teilen möchten, zum Beispiel mit denen, die in Afrika oder Afghanistan auf diese Welt kamen.
Schau auf die Medien in den letzten Wochen: 5 gegen 500. Fünf freiwillige Taucher aus der Gesellschaftsschicht der Milliardäre, seit dem 25. Juni verschollen auf ihrer Tauchfahrt zum Wrack der „Titanic“, sie nehmen mehr Raum in den Medien ein als der am 14. Juni gesunkene Fischkutter mit mehr als 500 Menschen, ertrunken auf ihrem Weg, vor Krieg, Hunger, Elend zu flüchten, das Los der Geburtenlotterie zu tauschen. Erst als Tauchroboter die Trümmer der „Titan“ 3800 Meter unter Wasser entdeckten, endete der inszenierte, die Aufmerksamkeit bindende Wettlauf gegen die Uhr über die Stunden, wie lange der Sauerstoff noch reichen könnte. Noch Tage nach der Nachricht vom Untergang des U-Boots Marke Eigenbau gibt es ein groß aufgemachtes Interview der BBC mit Christine Dawood, die Mann und Sohn bei dem abenteuerlichen Tauchgang zur „Titanic“ verlor. Wir erfahren, dass ihr Sohn, ein begnadeter Spieler mit dem Rubiks Cube, angemeldet beim Guinness-Buch der Rekorde, sich um einen Eintrag bewarb, dokumentiert mit einem Video seines Vaters: Weltrekord in knapp viertausend Meter Meerestiefe.
Neun Tage nach dem Untergang des Fischkutters eine Reportage aus der SZ über Ahmad aus Damaskus, einer der 104 Überlebenden, auf dem Weg aus seinem Container im Lager in das vom touristischen Leben gefüllte Athen. Ein Friseurbesuch, und er sieht nicht mehr aus wie ein Geflüchteter. So schreiben Raphael Geiger und Kristiana Ludwig und nennen ihre berührende Reportage in der SZ vom 28. Juni „Die unerträgliche Gleichzeitigkeit der Dinge“. Wie wahr. Diese großartige Seite 3 wirkt wie eine Illustration des Gedankenexpertimentes von John Ralws. Sie zeigt zugleich aber auch, die Unerträglichkeit des Raums, den die Berichterstattung über die fünf freiwilligen Taucher in unserer Öffentlichkeit einnimmt. Treffend schließen die beiden Journalisten: „Seit neun Tagen in Europa, zum ersten Mal in seinem Leben auf demokratischem Boden“. Ödön, ich möchte ergänzen: Auf ihm haben wir gerade den internationalen Flüchtlingsschutz verschrottet.
* Pija Lindenbaum, Der erste Schritt, 2023 Klett Kinderbuch, Leipzig

Mehrmals in einem Monat sitze ich mit Ödön von Horváth auf der Seidlbank vor dem Murnauer Rathaus. Das Ergebnis unserer Gespräche ist am ersten Mittwoch im Folgemonat hier zu lesen.